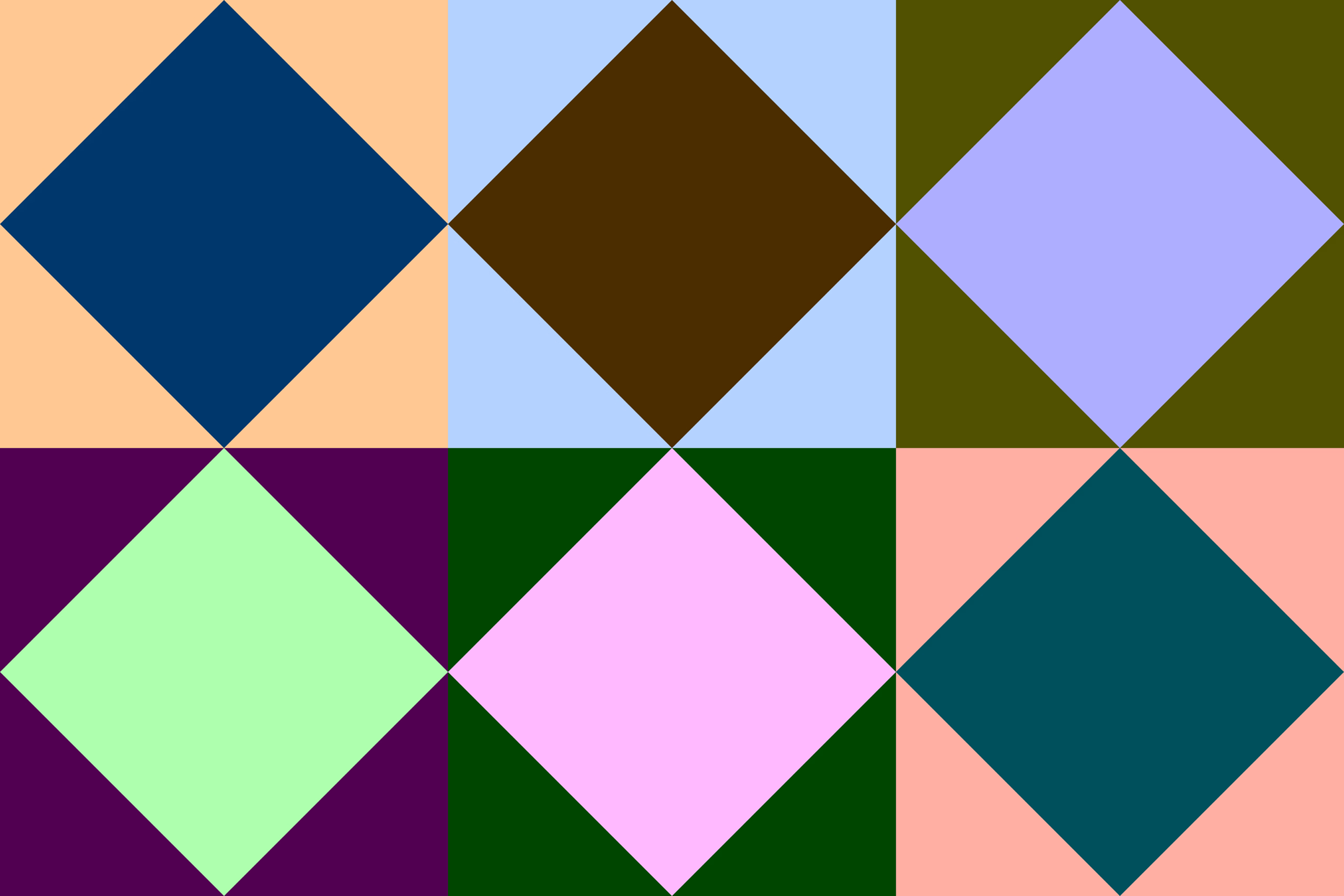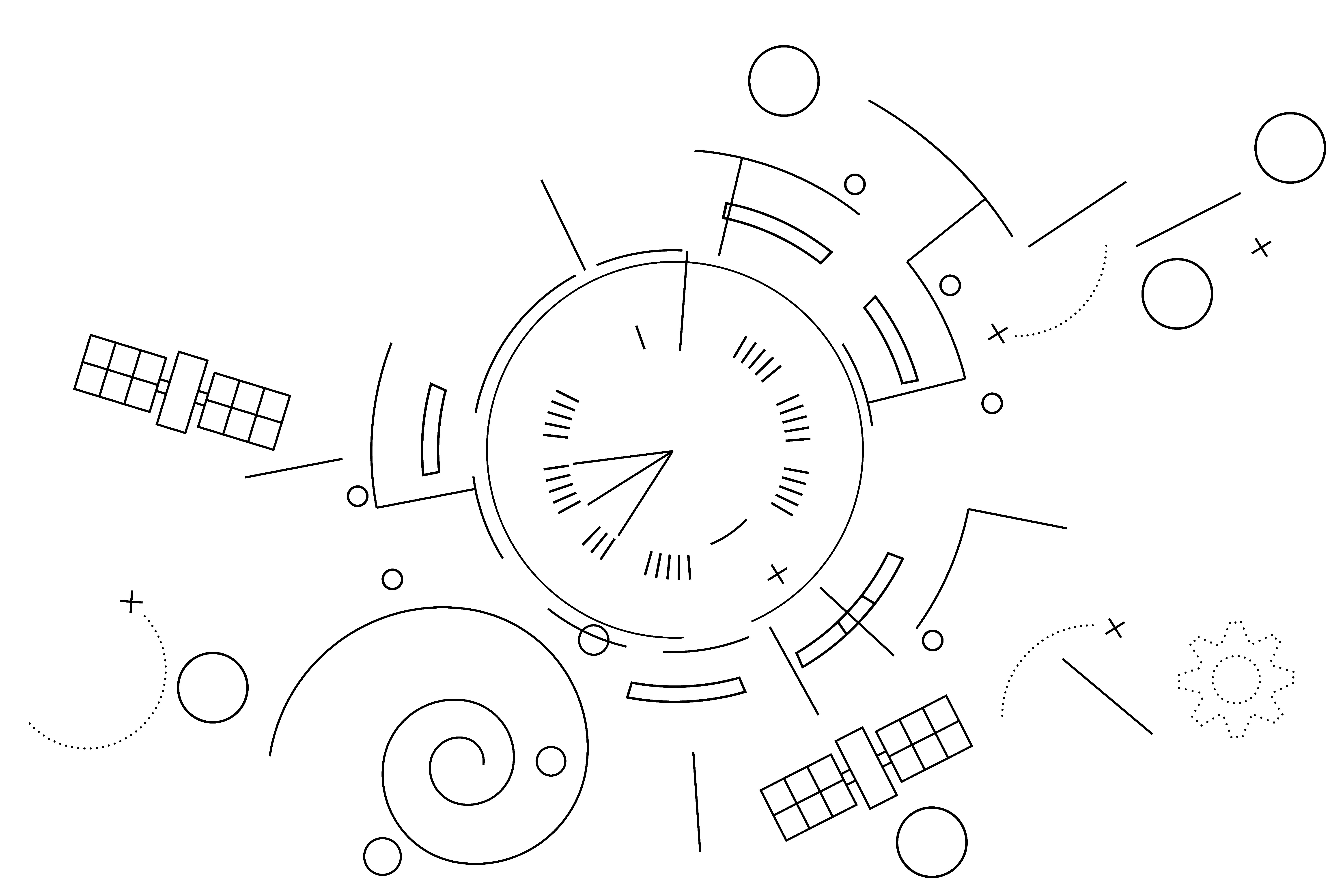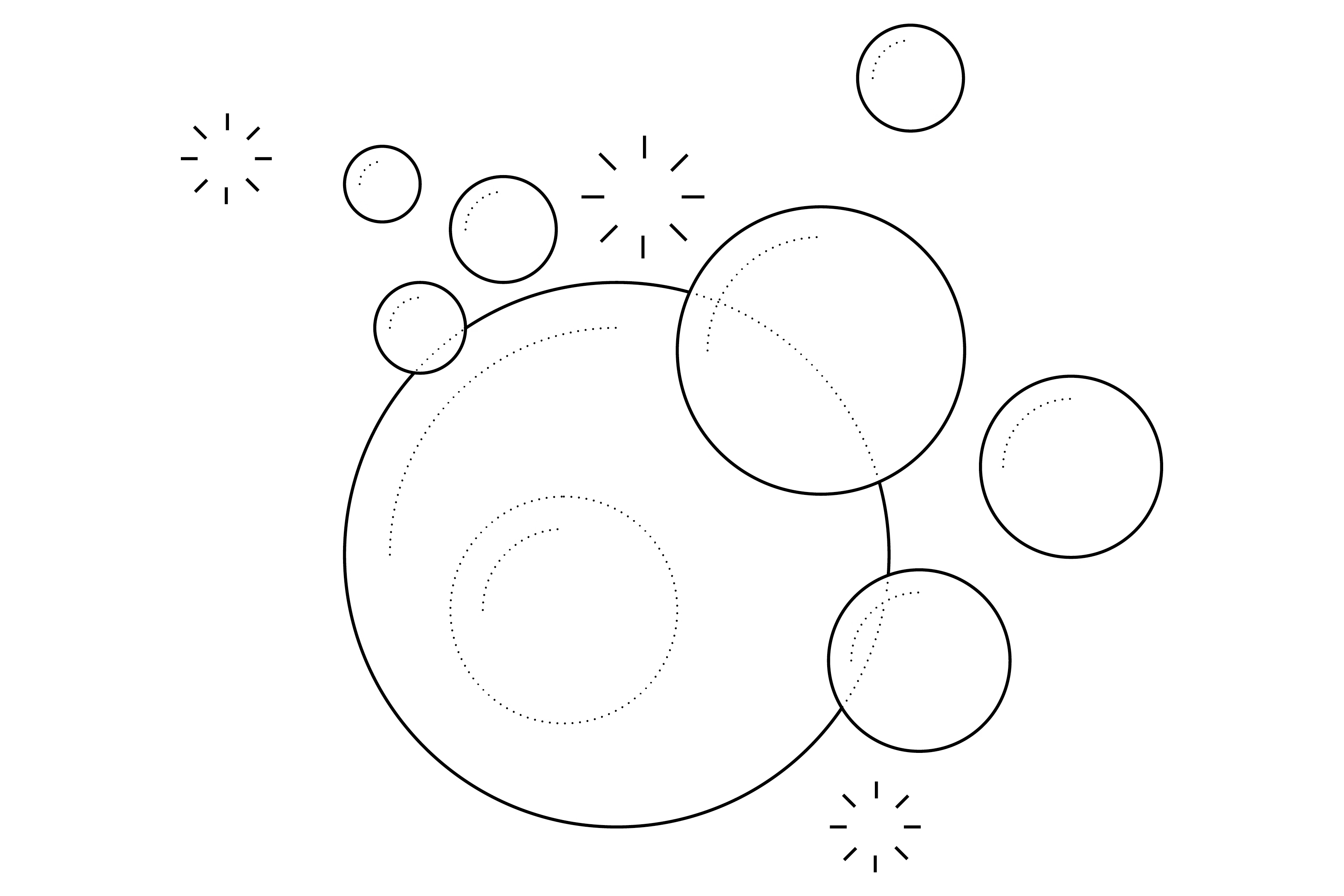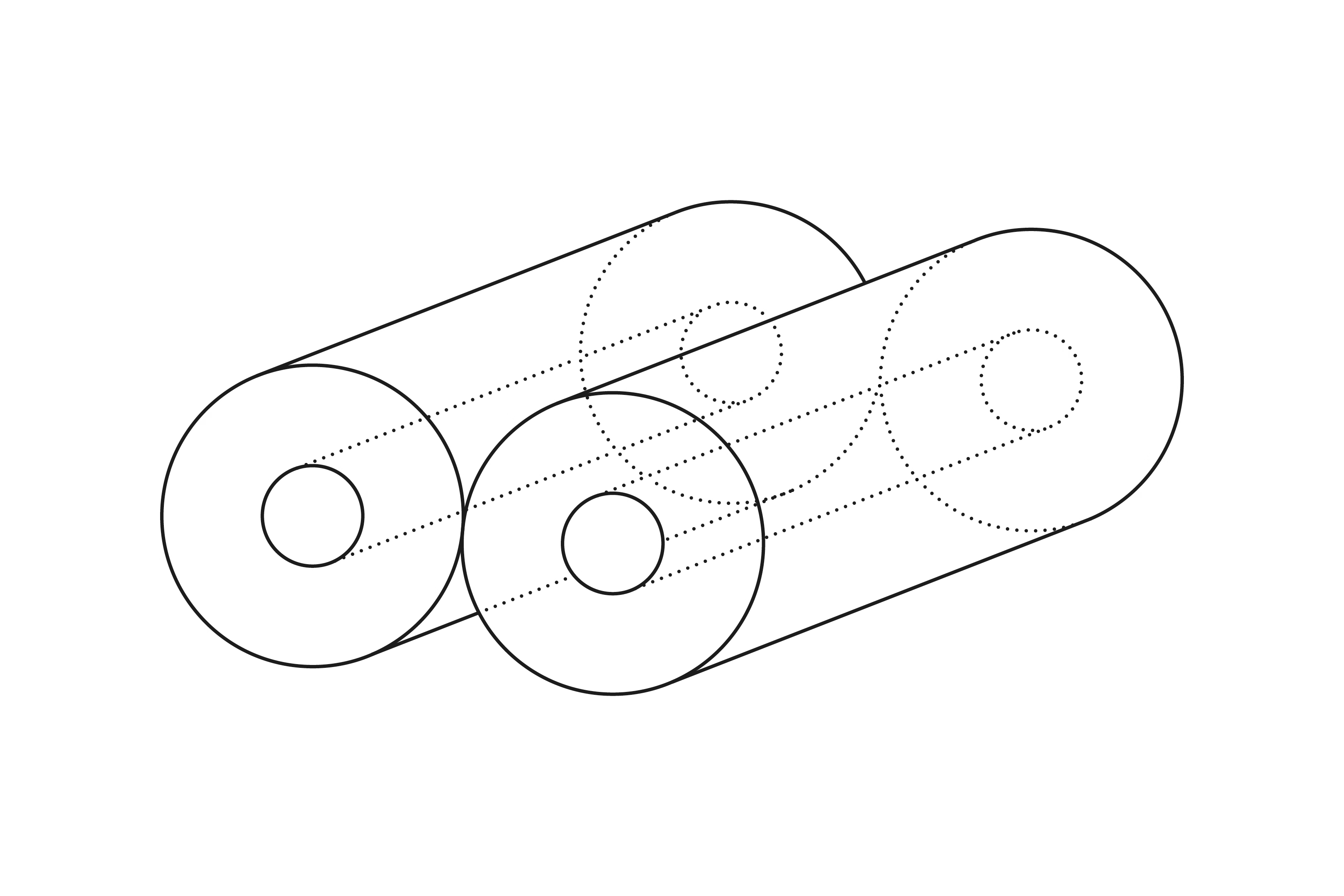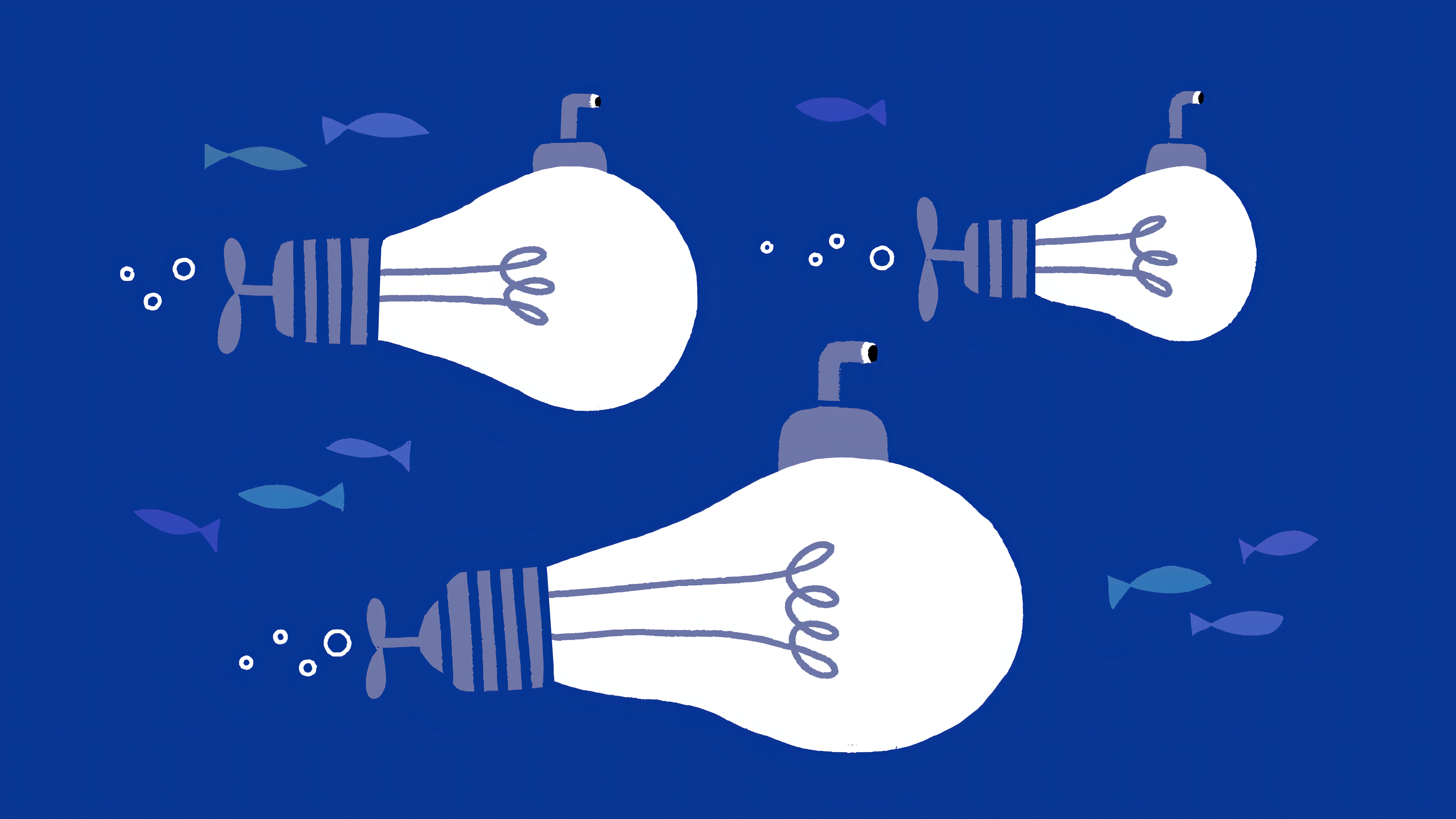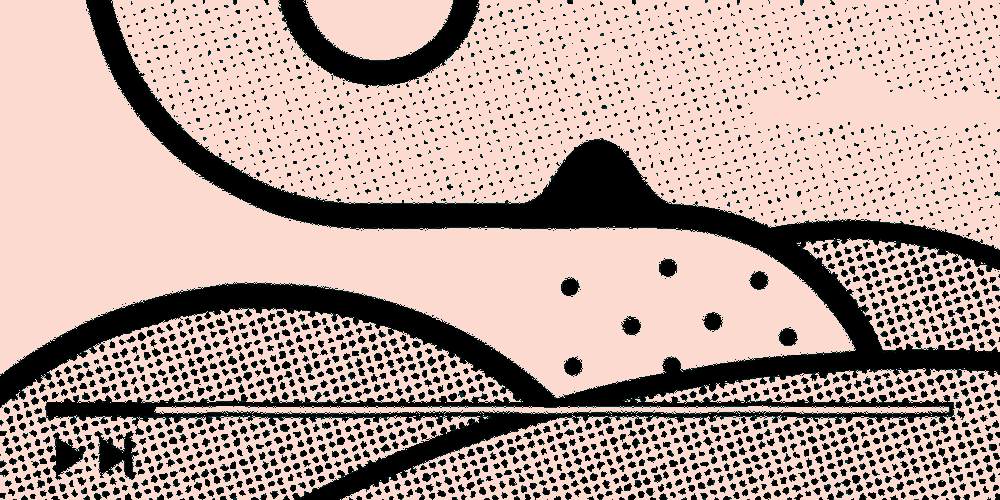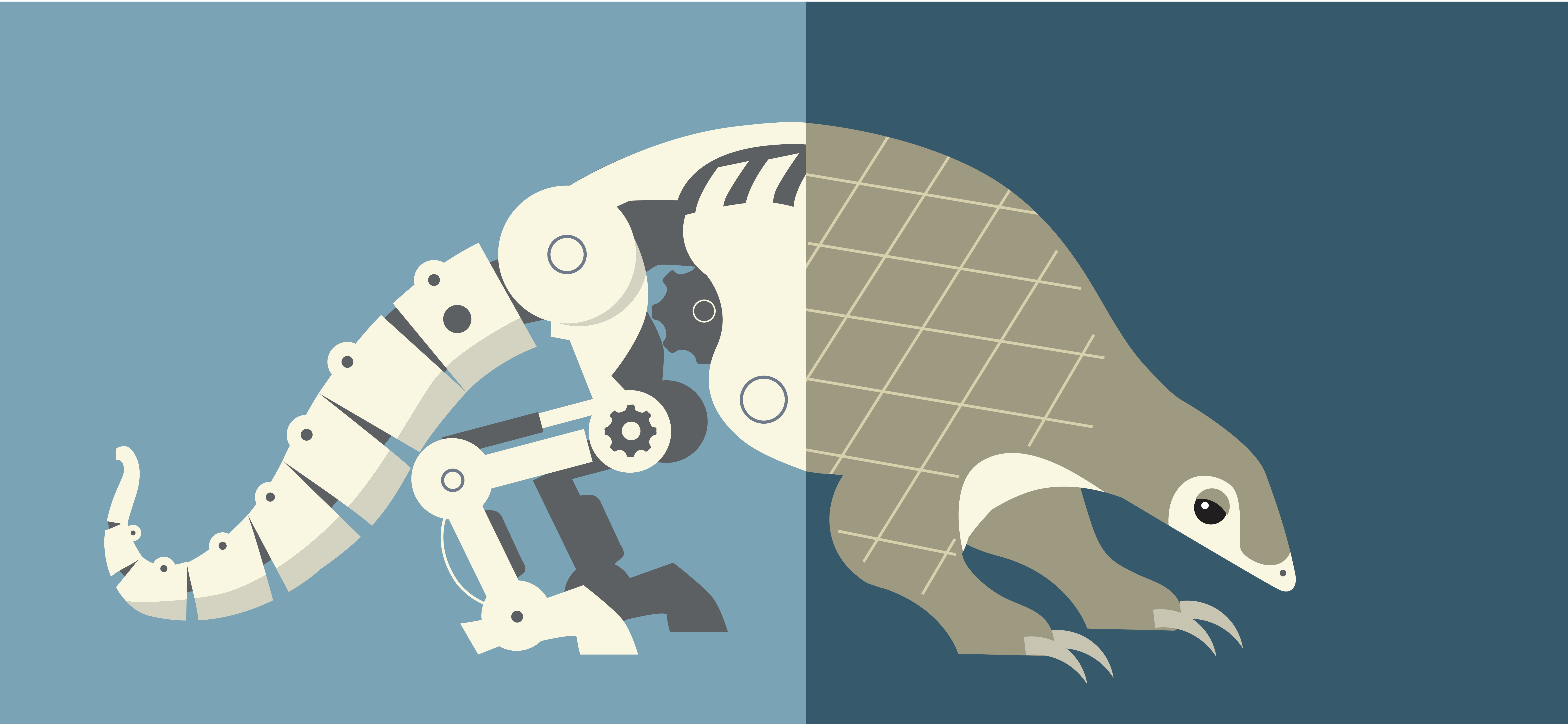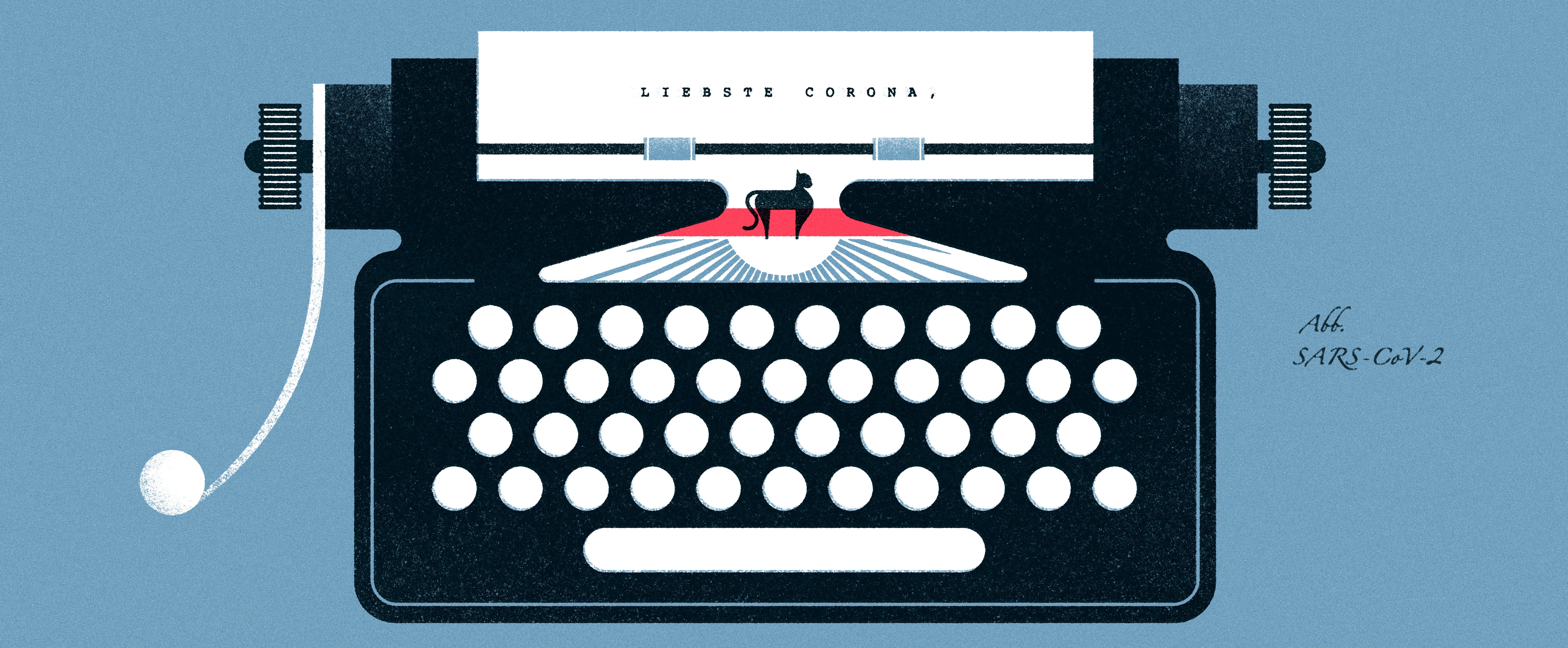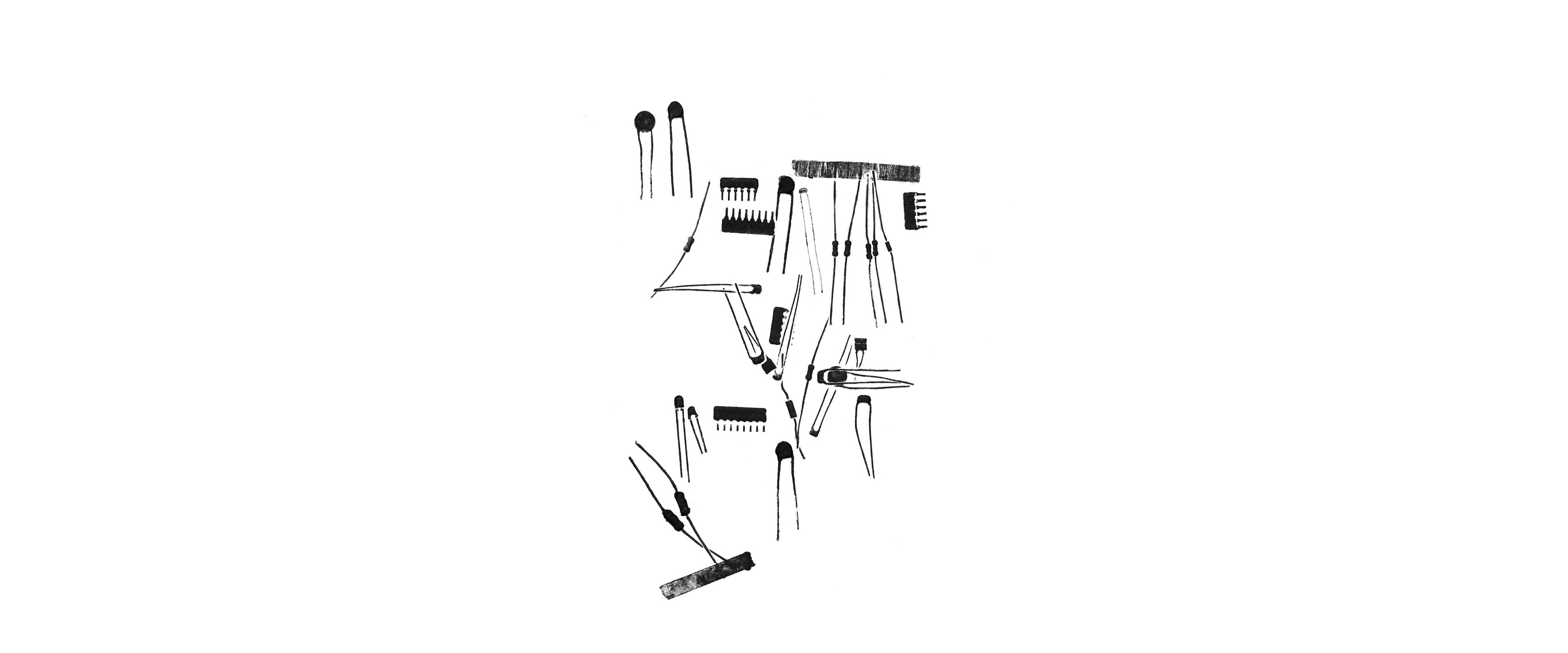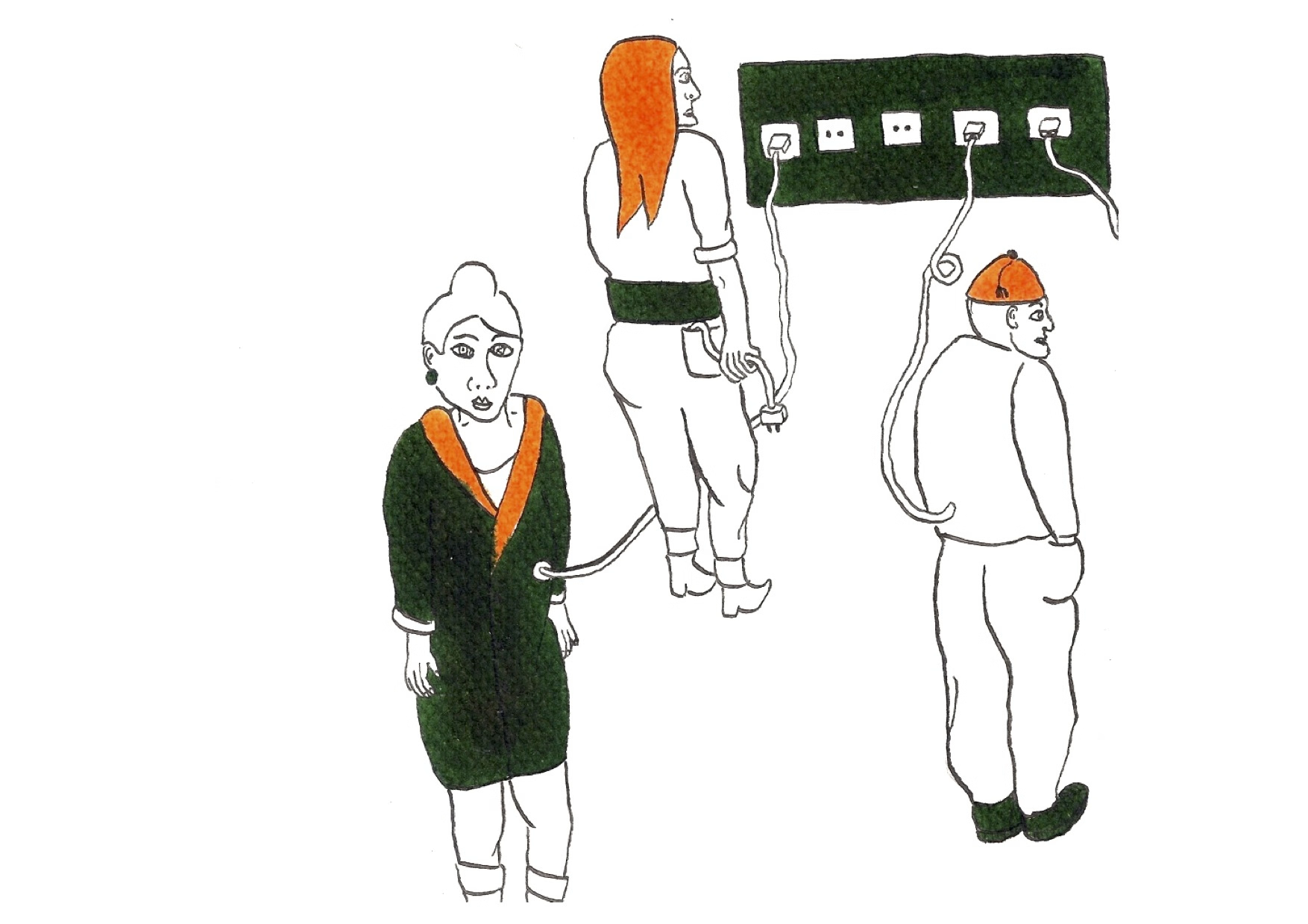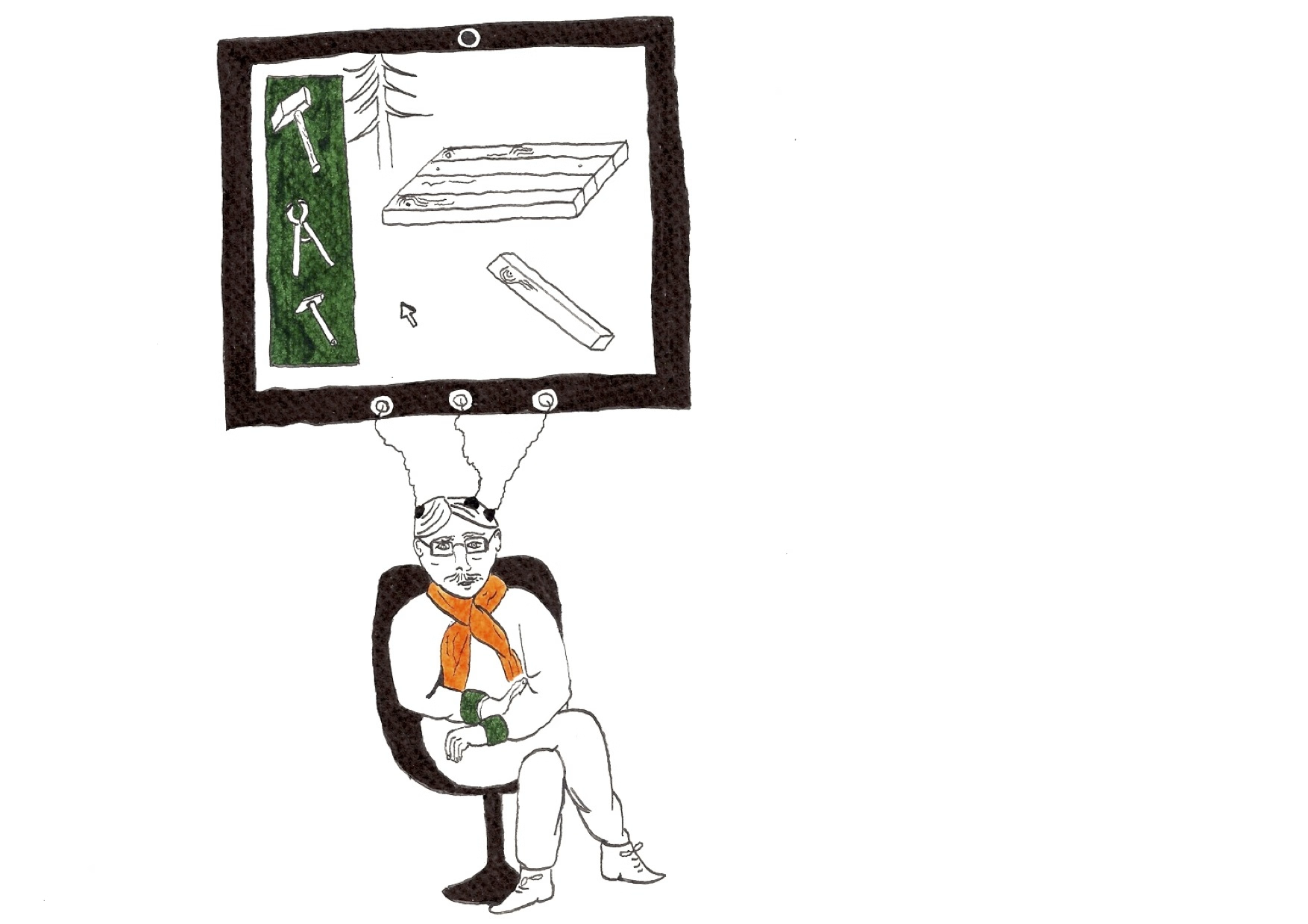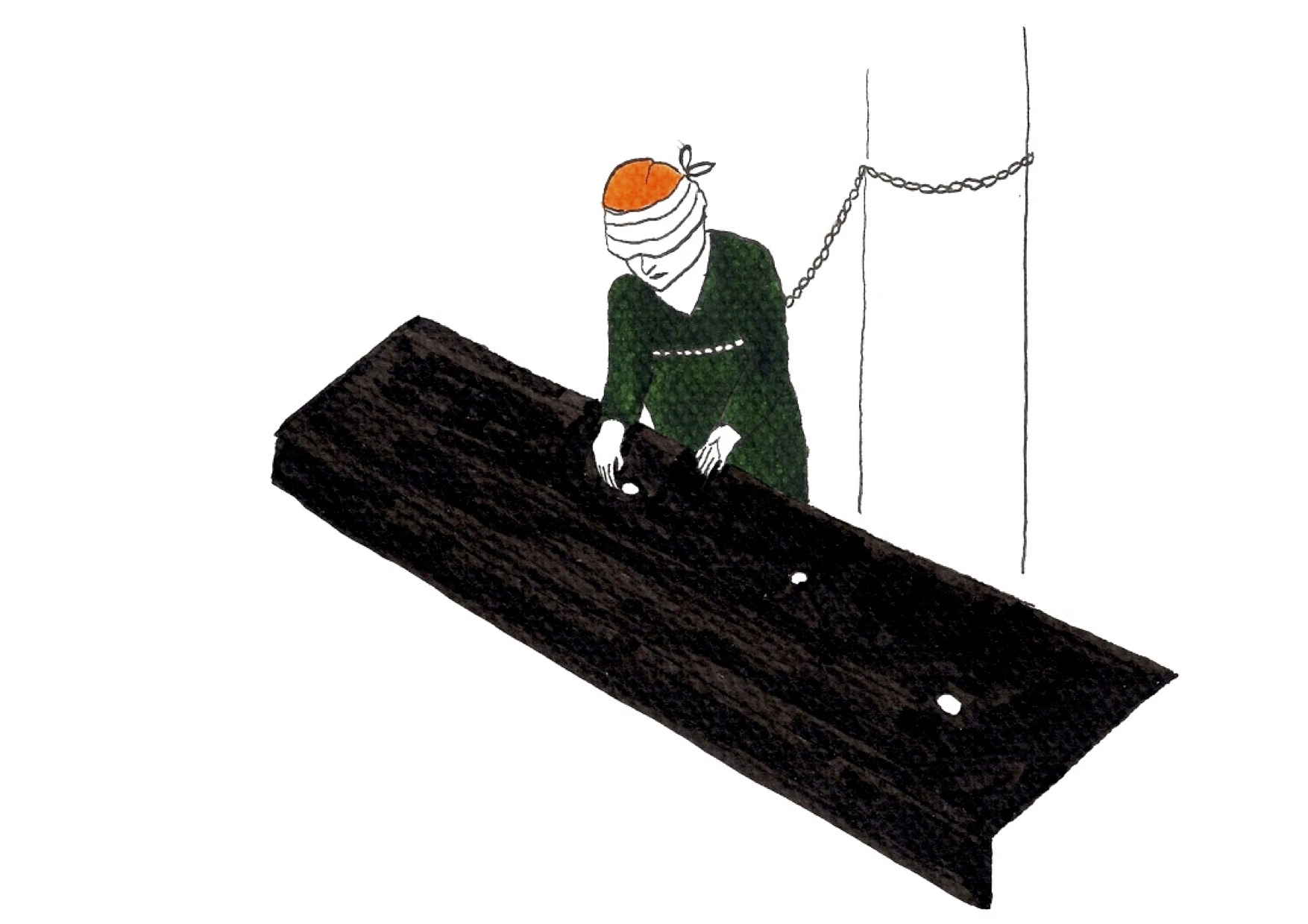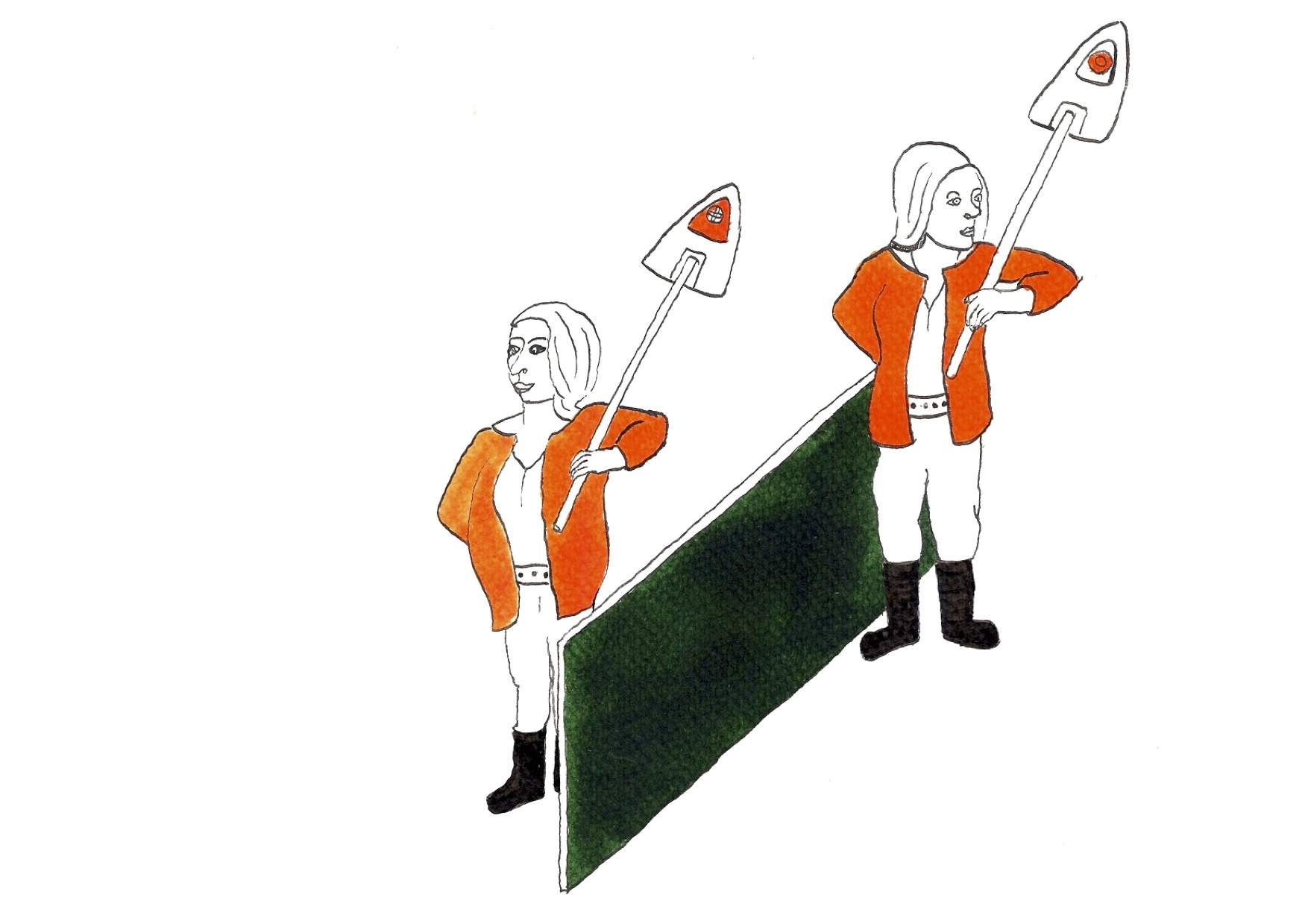Über das Kapital verfügend vs. dem Kapital ausgesetzt
Die siebte Trennlinie beschreibt die ungleiche Verteilung des Kapitals und damit die ungleiche Verteilung des Ertrags der Arbeit. Während das eine Segment über einen Grossteils des Kapitals verfügt, sind alle anderen dessen Wirkung ausgesetzt. Die Kapitalisten verfügen über die Produktionsmittel, bestimmen also was und wie produziert wird. Sie profitieren von den Renditen, die das Kapital, die Innovation und die Automatisierung abwerfen.
Das Segment der Kapitalisten
Die Kapitalisten verfügen über die gewachsenen Vermögen und die Anteile an den Unternehmen. Weil Kapital mit der Möglichkeit einhergeht, über andere Menschen zu bestimmen, ist auch die Macht ungleich verteilt. In Bezug auf die Arbeit zeigt sich die Macht im Diktat der Arbeitsbedingungen und Entlöhnung. Grund für ungleiche Verteilung des Kapitals sind die Renditen auf dem Vermögenswerten. Sie führen dazu, dass die Kapitalisten ihren Reichtum stetig vermehren, ohne dafür etwas tun zu müssen. Dieser Finanzadel kann, sofern es ihm nicht langweilig wird, einzig von Zinsen, Dividenden und Verkaufserlösen leben, ohne jemals eine Stunde zu arbeiten. Aus einer anderen Perspektive ermöglicht erst eine gewisse Konzentration des Kapitals grosszügige und wirkungsvolle Investitionen, die sowohl für den sozialen als auch den ökonomischen Fortschritt nötig sind. Die Arbeit des Kapitals ist also die Investitionstätigkeit.
Das Erbe ist der wichtigste Faktor, um zu Kapital zu kommen. Die zweite Möglichkeit, um Kapital zu erwerben, ist Arbeit. Je mehr Geld jemand verdient, desto mehr wird er sein Geld investieren und gelangt so in den Besitz von Unternehmensanteilen. Zudem werden die variablen Lohnanteile der Top-Manager oft mit Aktien entschädigt, die so dreifach verdienen - durch den Lohn, die Dividende und mögliche Kursgewinne. Arbeit wird umso grosszügiger entschädigt, je grösser der soziale Stellenwert, je grösser die Führungsspanne und je seltener die Kompetenzen einer Arbeitskraft sind. Ausbildung erhöht nicht nur den Lohn, sondern auch das Kapital und hat so letztlich doppelte finanzielle Konsequenzen. Durch Innovationen werden am Markt Innovationsrenditen erzielt: Die Innovationskraft erlaubt es, Produkte wesentlich über dem Produktionspreis zu verkaufen. Auch diese Innovationsrendite ist ungleich verteilt. Von einer Erfindung wie dem Ipad profitieren nicht die vielen chinesischen Arbeiterinnen, sondern die Manager in den USA sowie die Aktionäre.
Die globale Elite feiert sich selbst und sorgt durch die Regulierung des Zugangs zu exklusiven Netzwerken und exklusivem Wissen dafür, dass der Abstand zu den Unvermögenden bestehen bleibt.
Für den Zugang zum Kapital spielt es natürlich auch eine Rolle, ob man in einem Zentrum Westeuropas oder in den Slums von Indien geboren wird. Die Trennlinie des Kapitals ist deshalb nicht nur innerhalb, sondern auch zwischen Staaten zu verstehen. Auch Staaten sind Aktionäre, die über unterschiedlich viel Kapital verfügen. Das Kapital ist wesentlich mobiler als die Arbeit. Es bewegt sich dorthin, wo gute Geschäfte zu erwarten sind. Um Kapital von A nach B zu bringen, genügt heute ein Mausklick. Globale Mobilität heisst nicht, dass sich die Kapitalisten unter das Volk mischen. Vielmehr bringen die Kapitalisten eine ortlose globale Welt hervor, in der eigene Regeln und strenge Barrieren bestehen. Zugang zu diesen globalen Netzwerken erhält nur, wer über das entsprechende Kleingeld verfügt oder aufgrund zukünftig zu erwartenden Gewinne genügend interessant erscheint. Die globale Elite feiert sich selbst und sorgt durch die Regulierung des Zugangs zu exklusiven Netzwerken und exklusivem Wissen dafür, dass der Abstand zu den Unvermögenden bestehen bleibt.
Das Segment der Gekauften
Wer über das Kapital verfügt, kann in einer vom Wert der Aktien getriebenen Wirtschaft auch über die langfristigen Ziele und die Strategien des Unternehmens bestimmen. Diese werden in der Regel finanzieller Natur sein, weil die Kapitalisten weniger an guten Taten, als vielmehr am langfristigen Überleben des Betriebs und möglichst hohen Renditen interessiert sind. Der profitorientierte Aktionär wird die Produktionsbedingungen so wählen, dass möglichst viel Profit resultiert. Das schliesst das Drücken der Löhne ebenso ein, wie das Ersetzen von Maschinen durch Menschen, falls dies die Kosten senkt oder den Ertrag erhöht. Die Profitorientierung ist deshalb mit ein Grund, warum Arbeitsplätze verschwinden. Auch die Einführung von Mindestlöhnen kann diese Entwicklung begünstigen, weil Manager so versucht sind Menschen durch Maschinen zu ersetzen. Die Automatisierungsdividende ist wiederum ungleich. Vom Senken der Produktionskosten profitieren vor allem die Besitzer und das Top-Management.
Die Macht des Kapitals bedeutet letztlich, dass Mitarbeitende mit wenig Lohn, schlechten Arbeitsbedingungen und wenig Mitspracherecht die Grundlagen für den Wohlstand der Reichen schaffen. Plakativ ausgedrückt: Schlecht bezahlte Arbeit ermöglicht gut bezahlte Arbeit. So basiert die hohe Qualität der Infrastruktur einer Gesellschaft auf der Arbeit zahlreicher fleissiger Arbeiterinnen und Arbeiter im Hintergrund. Einfache Arbeiterinnen sind die Sklavinnen der Gegenwart. Allerdings befällt die Lust auf hohe Renditen nicht nur die Superreichen. Alle die Teil des kapitalistischen Systems sind, haben durch ihre Vorsorgen und Ersparnisse ein Interesse an Kapitalgewinnen. Wer möchte nicht seine Rente sichern, wer möchte nicht lieber 20% statt 1% Rendite auf seinen Ersparnissen? Wir alle sind zu Kapitalisten gewonden. Die Gekauften spielen deshalb das Spiel der Mächtigen mit, ohne sich gross zu wehren, denn eine Änderung der Spielregeln könnte ja auch zu ihren Lasten gehen.
Die Kapitalisten sorgen dafür, dass die soziale Mobilität nicht zu gross wird, denn Aufsteiger könnten ihnen gefährlich werden und ein ebenso grosses Stück am globalen Wohlstandskuchen fordern.
Hochqualifizierte, Innovatoren und Besitzer seltener Fähigkeiten können ebenso wie Kapitalisten ihre Heimat rasch wechseln. Sie haben das nötige Kleingeld und die nötigen Beziehungen, um rasch eine neue Heimat und neue Arbeit oder Investionsgelegenheiten zu finden. Das gilt umso mehr, wenn sie einer Arbeit nachgehen, die überall in der Welt gefragt ist oder die man von irgendeinem mit dem Internet verbundenen Computer erledigen kann. Diese globale Elite bewegt sich in einer kapitalistischen Kultur, die in New York, Dubai, Tokio und Zürich überall gleich aussieht und nach denselben Regeln und Werten funktioniert. Die einfachen Arbeitenden sind dagegen aufgrund ihrer Fähigkiten und Aufgaben an einen Ort gebunden. Diese Einschränkung der Mobilität gilt auch in Bezug auf die sozialen Aufstiegschancen. Die Kapitalisten sorgen dafür, dass die soziale Mobilität nicht zu gross wird, denn Aufsteiger könnten ihnen gefährlich werden und ein ebenso grosses Stück am globalen Wohlstandskuchen fordern.
Über die Verteilung von Kapitalisten und Gekauften
Bei der zukünftigen Verteilung des Kapitals spielt das Matthäus-Prinzip eine zentrale Rolle: „Wer hat, dem wird gegeben“. In Bezug auf die Verteilung des Kapitals besagt es, dass die Reichen immer reicher werden, während die Armen gleich arm bleiben oder sogar noch ärmer werden. Durch die Renditen auf dem Kapital, der Innovation, der Bildung und der Automatisierung vergrössert sich der Abstand zwischen den tiefsten und den grössten Einkommen sowie zwischen dem tiefsten und dem höchsten Vermögen. Das Entstehen von Megakonzernen begünstigt die Konzentration von Macht, Vermögen und hohen Einkommen. Aus dem Mätthäus-Prinzip folgt, dass die Grenzen zwischen den sozialen Schichten stabiler werden und die Mobilität zwischen den Klassen eingeschränkt wird. Die Verteilung der Einkommen und Vermögen definiert soziale Gemeinschaften, die wiederum über die Qualität der Netzwerke entscheiden. Je mehr die Netzwerk in exklusive Kreise führen, desto lukrativer ist die verfügbare Arbeit.
Je grösser die Unterschiede zwischen den Verfügenden und Gekauften, je undurchlässiger die sozialen Schichten, je schlechter der Bildungszugang für die Unprivilegierten, desto grösser wird der Ärger der Gekauften. Je besser dieser Ärger organisiert wird, desto grösser wird die Gefahr für die Kapitalisten. Neben terroristischen Akten oder die Manipulation der Börse könnten die Gekauften streiken oder die Produkte und Dienstleistungen der Kapitalisten boykottieren und so einen ökonomischen Stillstand provozieren. Diese Gefahr besteht in nationalen Dimensionen, natürlich sind aber auch globale Streiks denkbar, bei denen Staaten andere durch das Zurückhalten von Vorleistungen, Rohstoffen oder Energien erpressen. Die Kapitalisten werden deshalb darum bemüht sein, gar keinen Ärger aufkommen zu lassen. Das gelingt am besten, indem die Menschen strategisch (nicht) informiert werden, durch schöne Konsumwelten verführt oder in unterhaltsamen Simulationen gefangen werden. Konsumenten und Mitarbeitende haben dann das subjektive Gefühl, in der besten aller Welten zu leben, freilich ohne die Welt anderer Schichten oder die verstärkenden Machtmechanismen zu kennen.
Steuern sind das wichtigste und wirkungsvollste Instrument, um Kapital umzuverteilen. Damit es wirklich zu Umverteilung kommt, braucht es progressive Steuern, die jene besonders jene treffen, die viel Einkommen und Vermögen haben. Konkret geht es nicht um diejenigen, die pro Jahr mehr als 100.000 Franken verdienen, sondern um diejenigen globalen 1%, die durch ihr Kapital über den Rest der 99% herrschen. Durch die Besteuerung von Erbschaften, Mobilität und Konsum kommt es zu sozialer Umverteilung. Je progressiver die Einkommens- und Vermögenssteuern gestaltet sind, desto mehr wird umverteilt. Durch die Digitalisierung der Finanzströme tun sich neue Möglichkeiten der Besteuerung auf. Es wäre denkbar, jede Transaktion an der Börse, jede ausgestellte Rechnung oder auch jedes Bankkonot automatisch zu besteuern. Umverteilung verbessert die soziale Mobilität und wirkt so langfristig auch der Gefahr von Gewalt und Terrorismus entgegen. Im globalen Zusammenhang stellt sich die Frage, wo die Megakonzerne angesiedelt sein werden, und welche wirtschaftliche Kriegsmacht (z.B. Daten, Monopole, Zinsen) sich daraus ergibt.