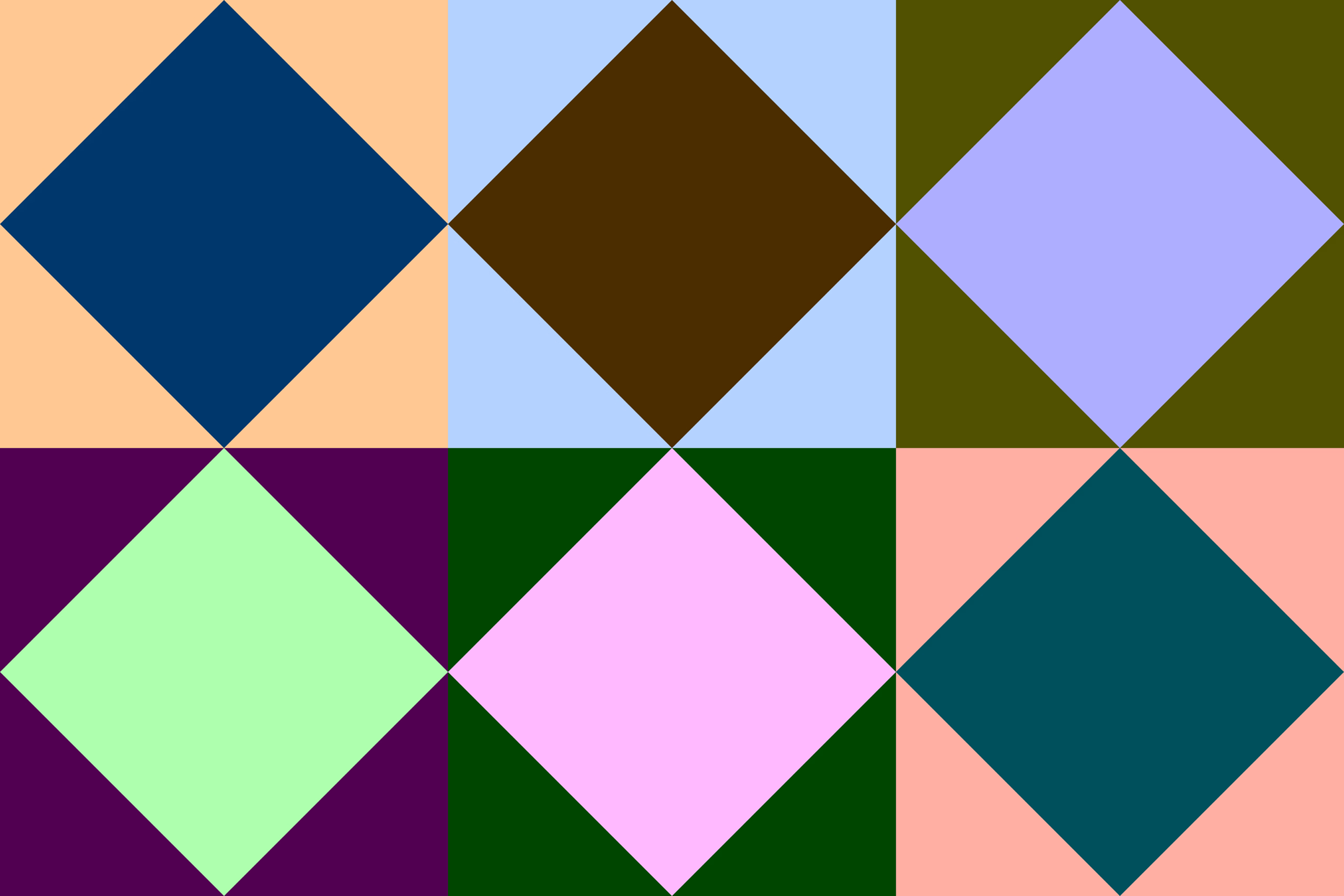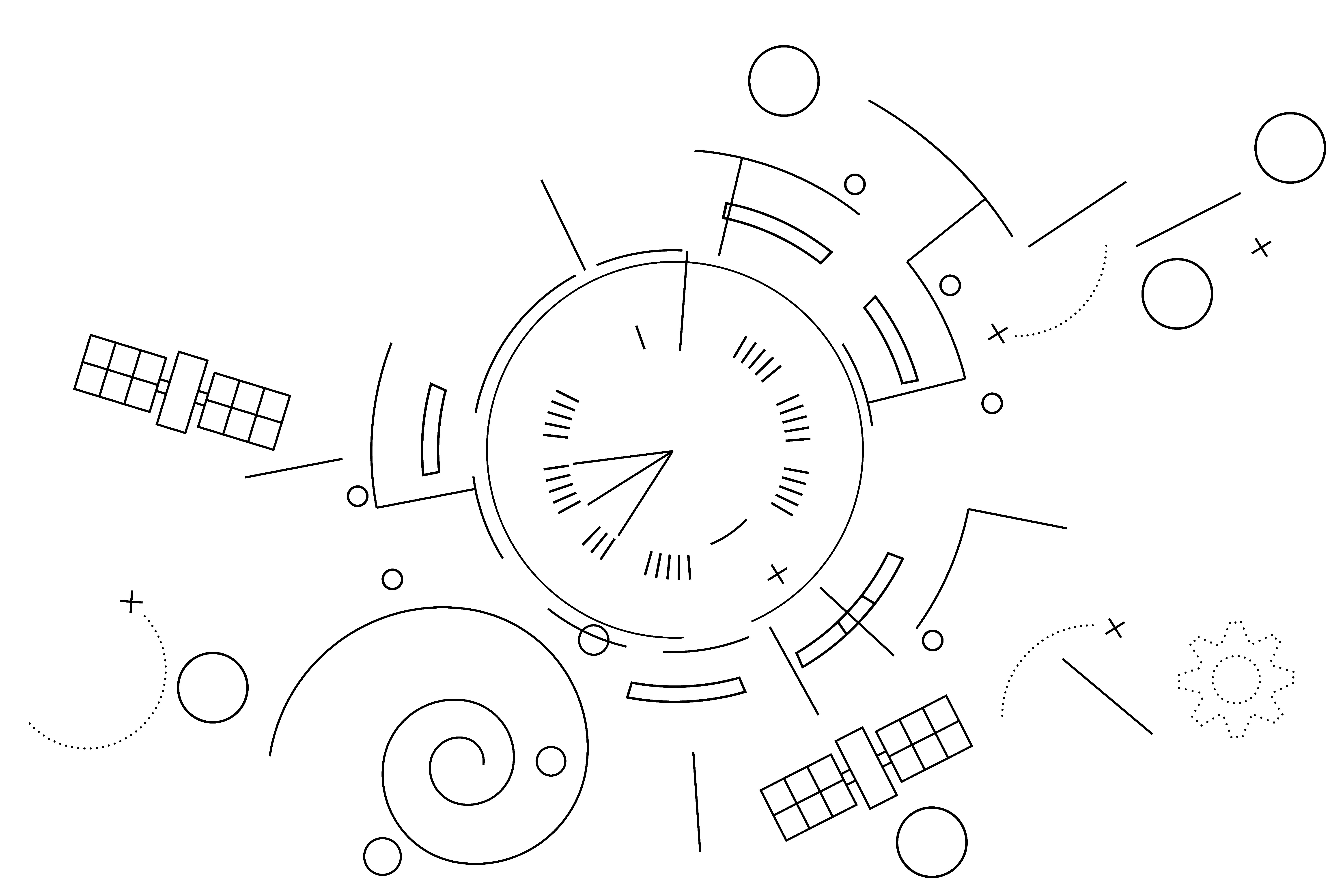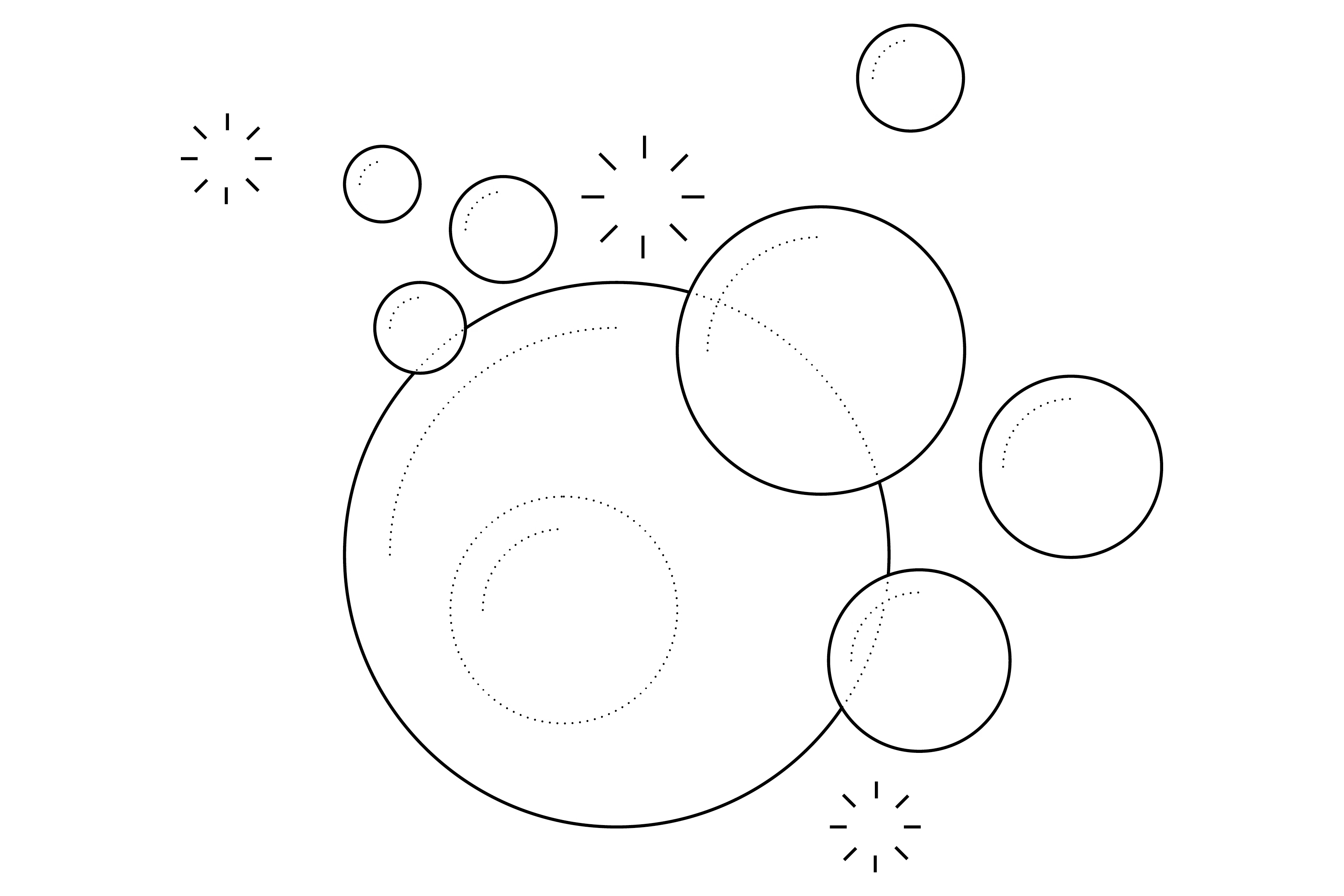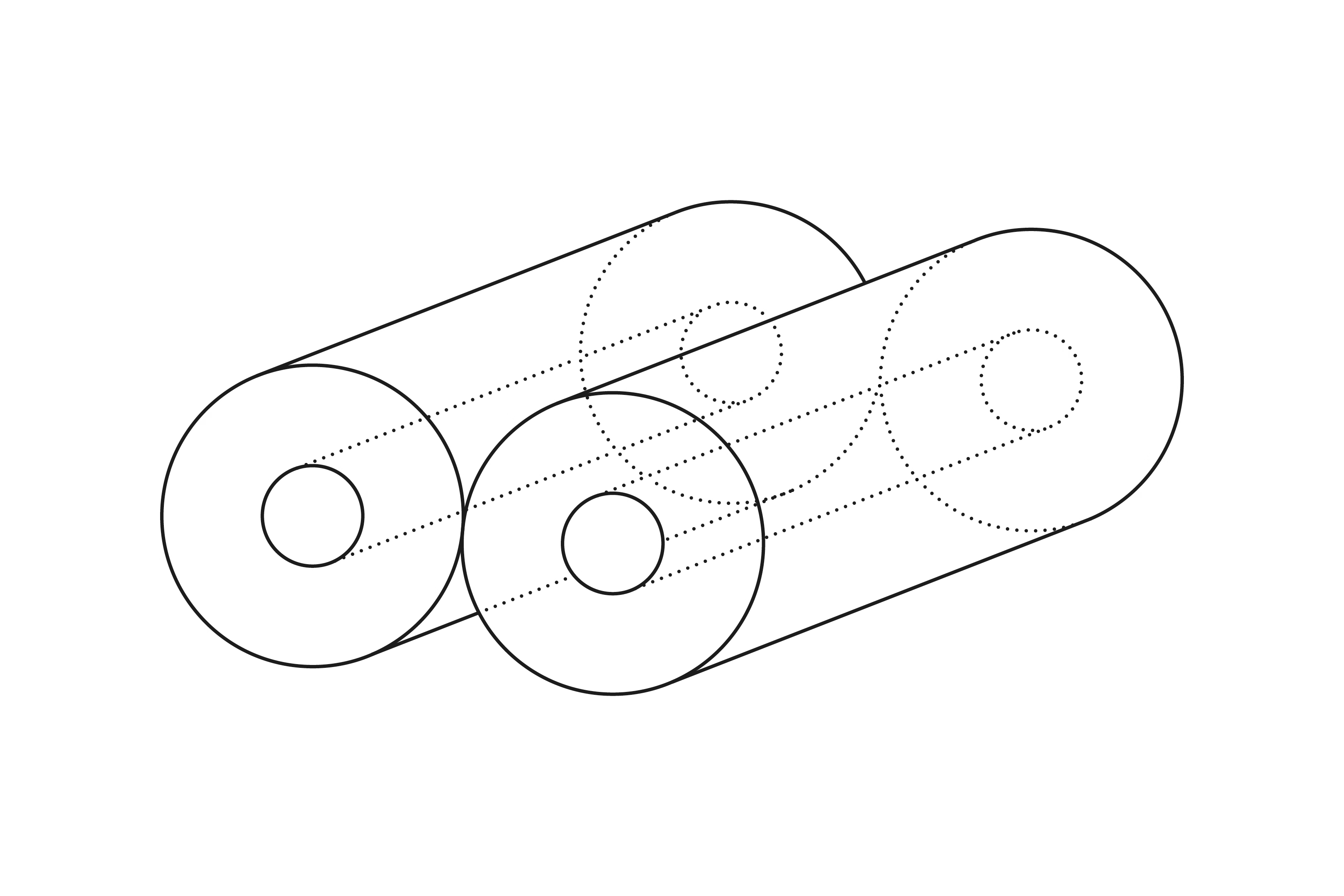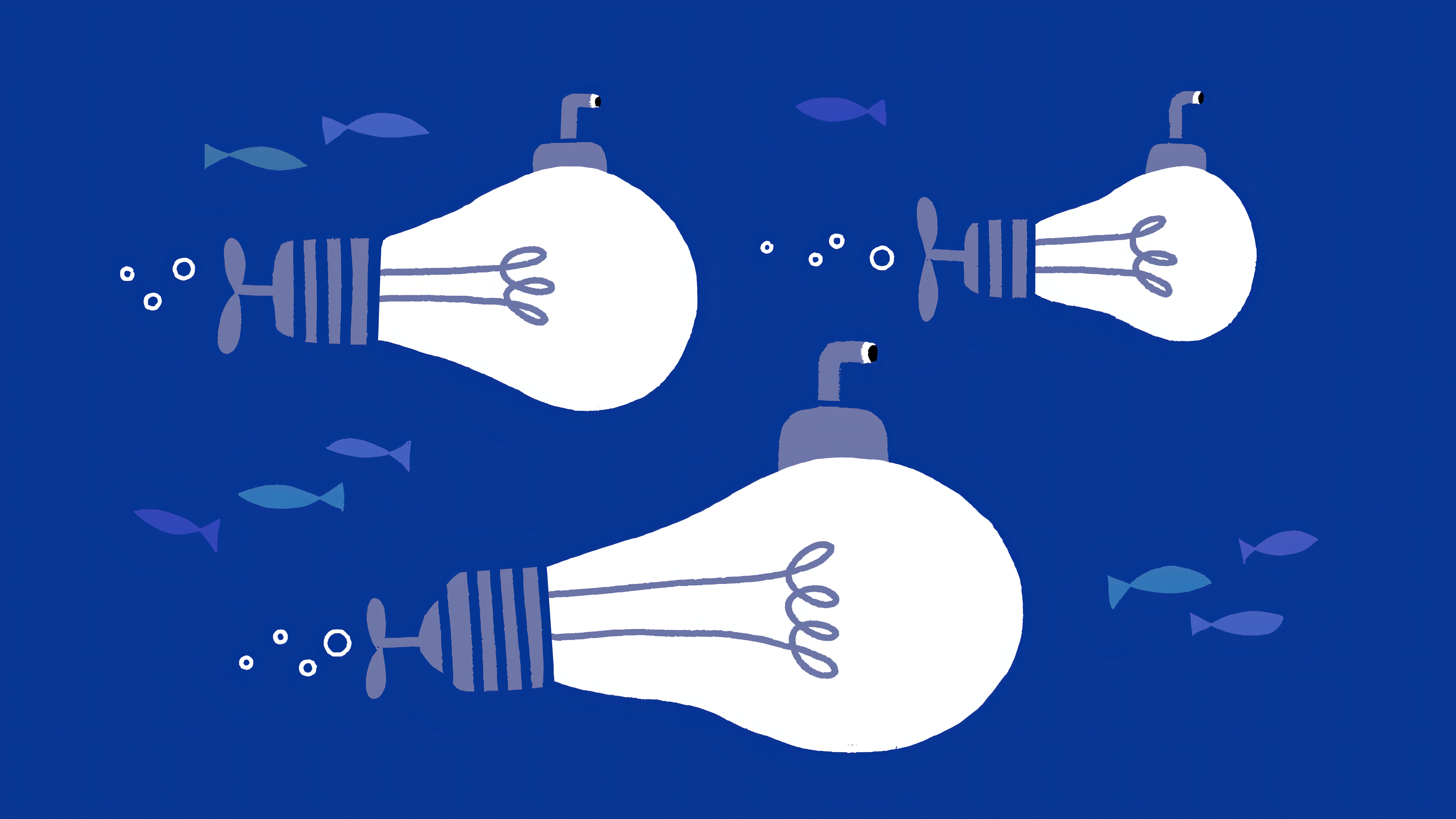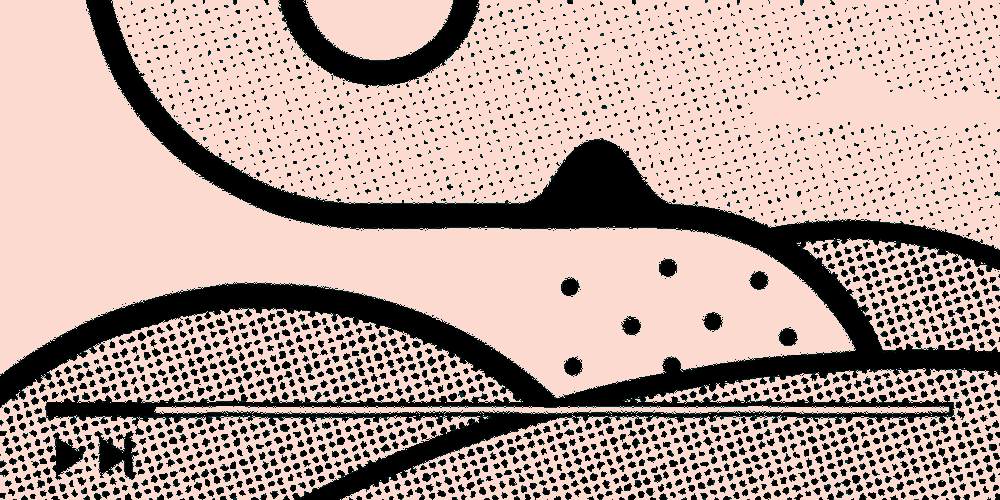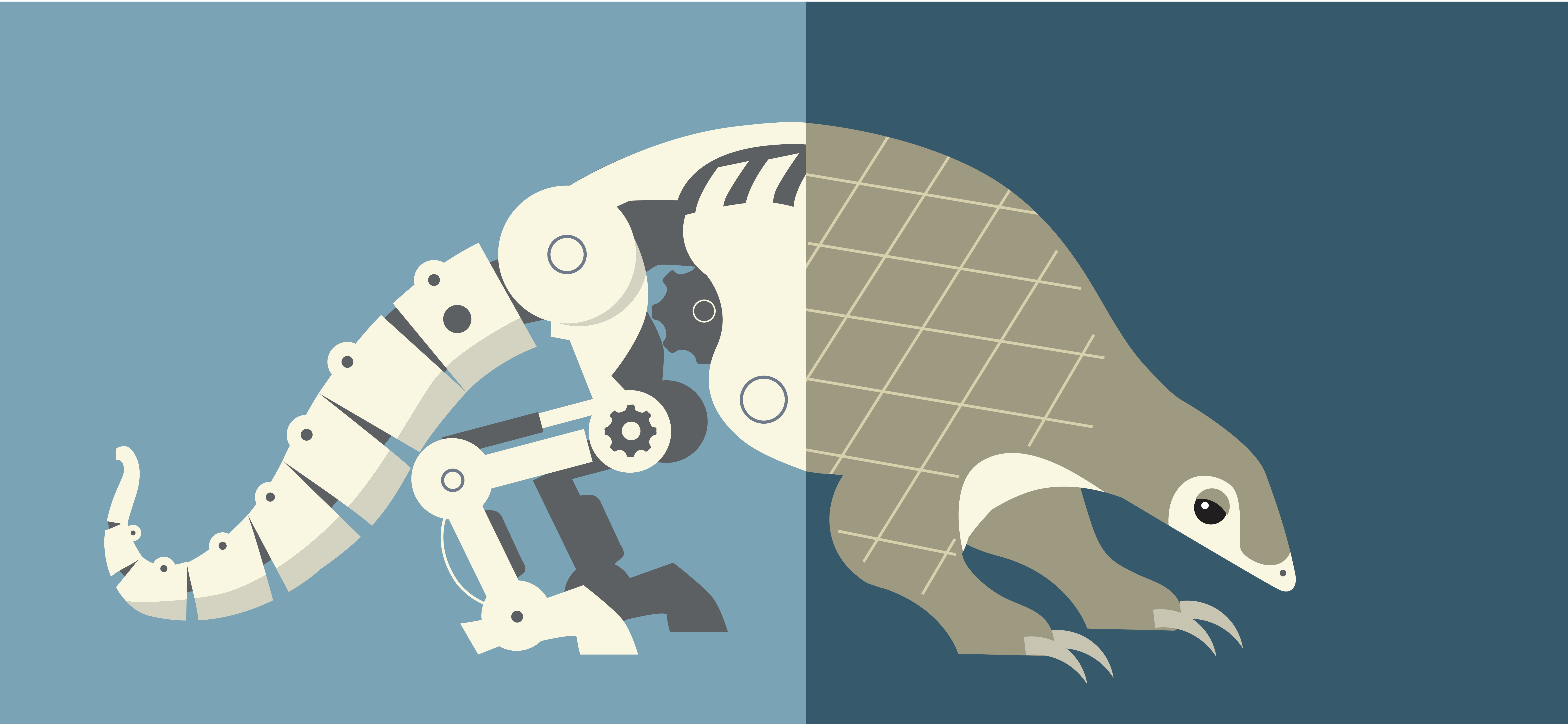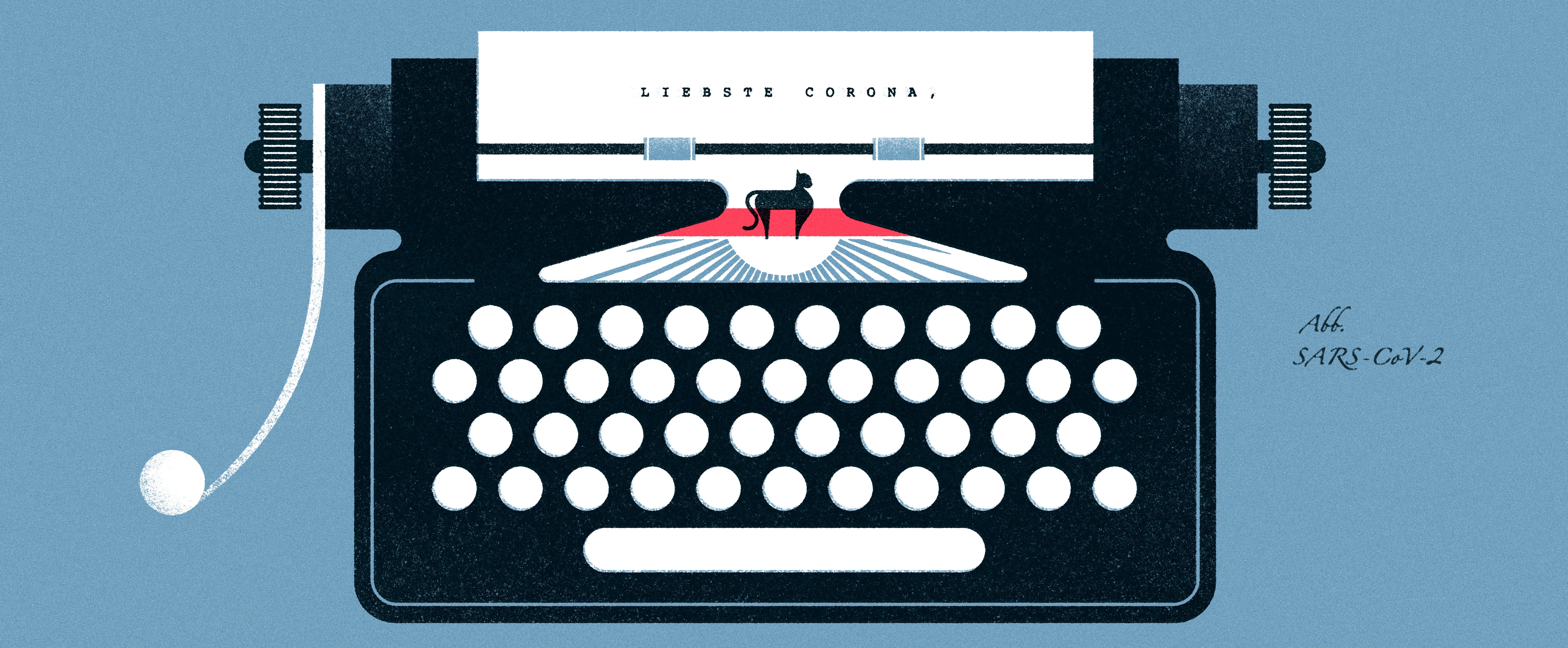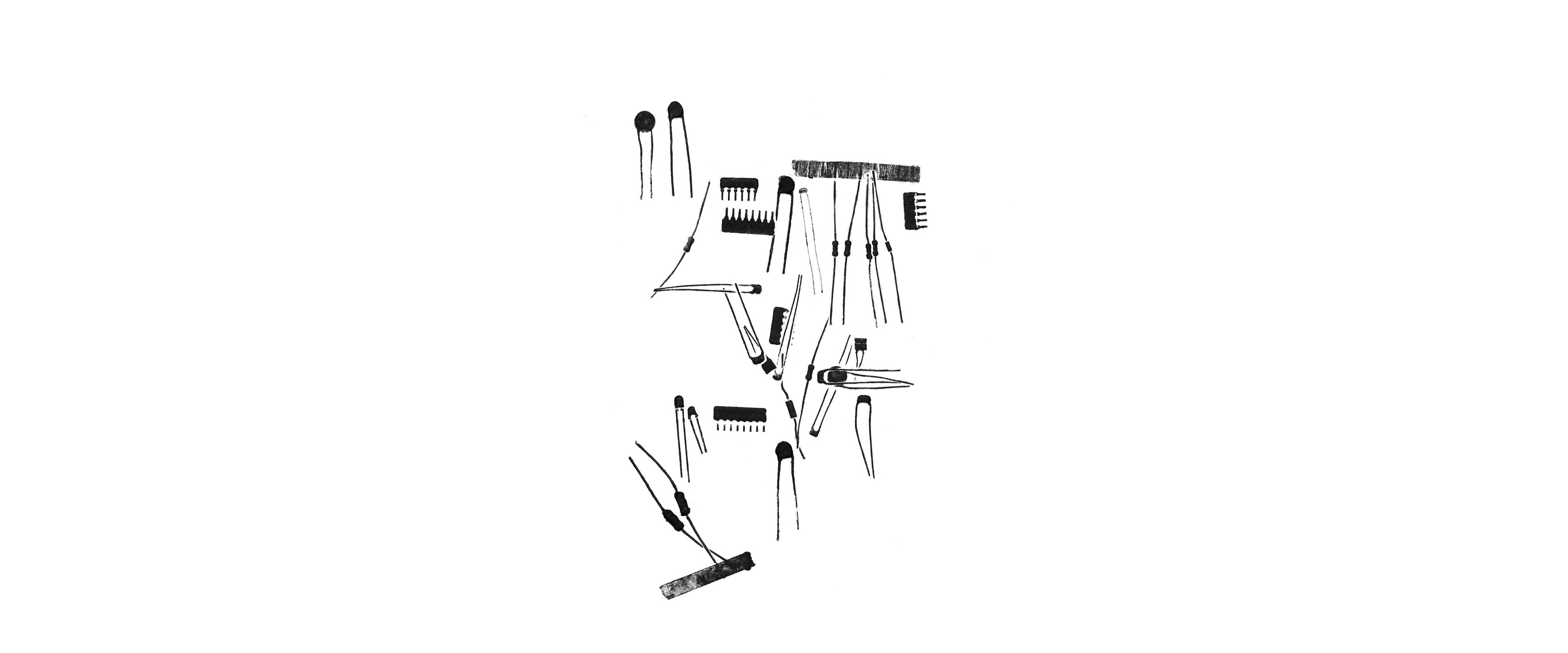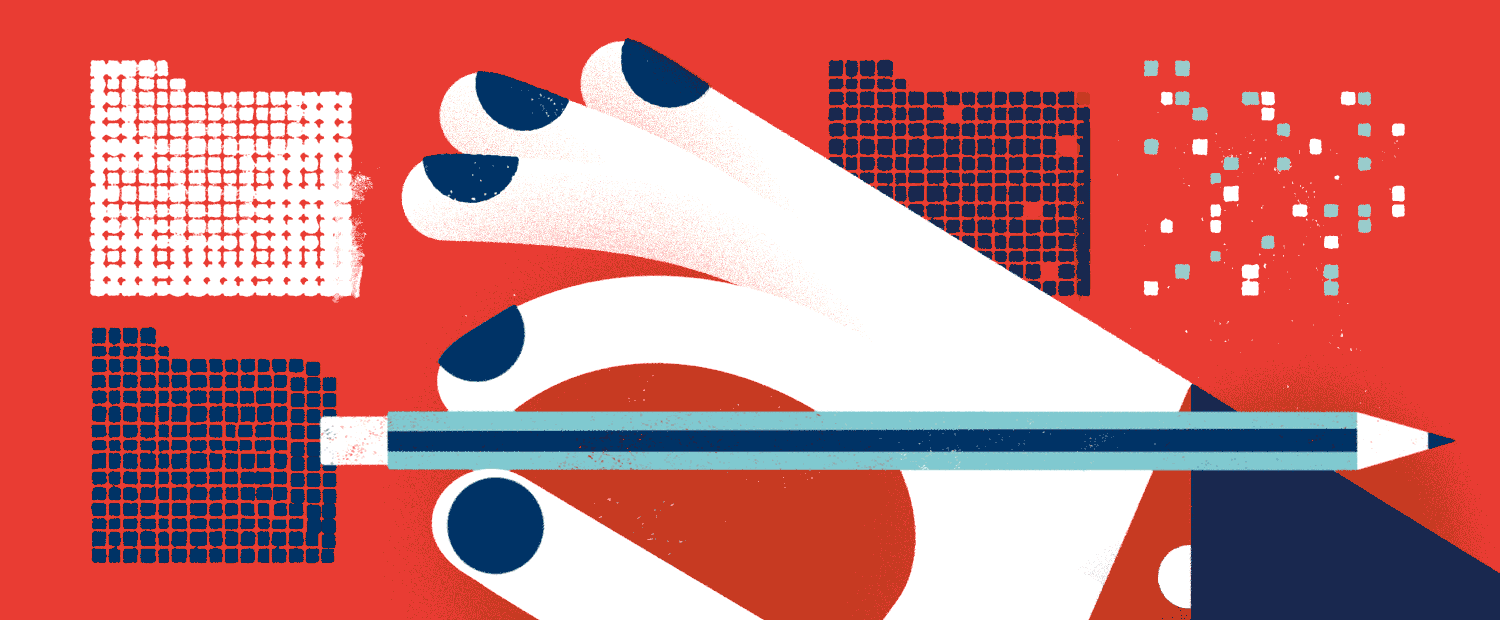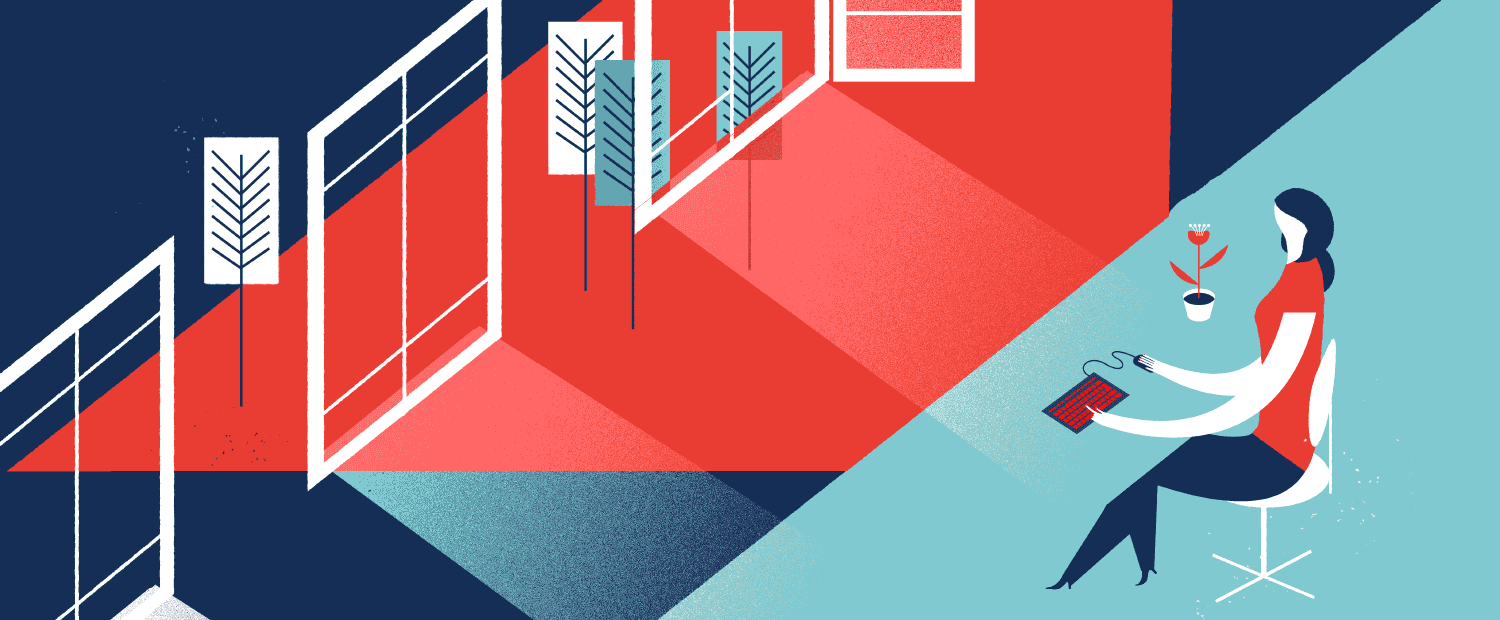Von Push- zu Pull-Leadership
Nun stellt sich natürlich die Frage, wie auf die Kultur eingewirkt werden kann. Zum einen nimmt man – bewusst und unbewusst – über die bisher thematisierten Aspekte der neuen Arbeitswelt (Mensch-Maschinen-Verhältnis, physische und digitale Arbeitsumgebung und Arbeitsumgebung) Einfluss. Ein weiteres Element der Einflussnahme ist die Thematisierung und Veränderung des Führungsverständnisses. Um die Hypervernetzung zum Leben zu erwecken, braucht es eine Abkehr vom Push-Verständnis der Führung. Ausgeprägter Kontrollglaube und Wissenstresore schwächen die Adaptionsfähigkeit und -geschwindigkeit. Beim Pull-Leadership entwickeln Führungskräfte Ideen und Visionen gemeinsam mit ihren Mitarbeitenden. Diese gleichen damit in ihrem Verhalten DJs. Der Fokus der Tätigkeit liegt in der Gestaltung eines Umfelds, in dem sich Menschen entfalten können. DJs wählen dazu Musik aus, die zu Lokal, Anlass, Uhrzeit und Party-Gästen passt – Führungskräfte gestalten das Umfeld durch die räumliche, inhaltliche und soziale Organisation der Arbeit. Der Abend wird nur dann erfolgreich sein, wenn die DJane sorgfältig beobachtet, wie sich das Publikum verhält, und so aktiv Feedback einholt. Das gilt auch für Führungskräfte.
Führungskräfte als DJs
Eine wichtige Eigenschaft der DJane ist ihre Rückkehr ins Partypublikum. Zwar steht sie für zwei Stunden im Zentrum der Geschehens, sie kehrt danach aber ganz selbstverständlich ins Publikum zurück. Die Rückkehr ins zweite Glied gilt auch für Führungskräfte der Zukunft. Für die Koordination eines Netzwerks braucht es andere Fähigkeiten als für das Regieren einer Pyramide. Pull-Führungskräfte übernehmen in gewissen Projekten den Lead, haben aber kein Problem damit, bei anderen Projekten andere Rollen zu übernehmen und aus dem Mittelpunkt zu treten. Situativ soll jene Person die Führung übernehmen, die aufgrund ihrer Fähigkeiten, Netzwerke und Erfahrung am besten geeignet ist. Führungskräfte sind damit vor allem Themen- oder Prozessowner. Diese Vorstellung der Gleichberechtigung missfällt Chefs mit einem traditionellen Führungsverständnis. Sie haben häufig Angst, Einfluss, Kontrolle und Status zu verlieren. Umgekehrt ist das Vorleben der neuen Führungskultur durch das Top Management entscheidend. Lernreisen, Rollenwechsel, der Austausch mit der Gen Y oder Exkursionen in andere Betriebe helfen beim Sensibilisieren des Top Managements.
Design von Karrieren
Um sich von traditionellen Führungsverständnissen zu lösen, spielt das Design der Karrieren eine zentrale Rolle. Neue Karrieren sind nicht nur eine Notwendigkeit der veränderten Organisationsarchitektur, sondern auch eine Folge der geringeren Bereitschaft der Generation Y, klassische Führungsrollen und -karrieren anzunehmen. Die vertikale Karriere, bei der alle möglichst schnell die Hierarchie hochklettern, wird durch eine Vielfalt von Entwicklungsmöglichkeiten abgelöst. Karriere dient dazu, Autonomie, das Netzwerk und das Kompetenzerleben zu vergrössern. Dabei sind horizontale Karrieren hilfreich, mit denen man sein Kompetenz-Portofolio erweitert und vertieft – durch eine andere Tätigkeit im selben Betrieb oder derselben Tätigkeit in einem anderen Bereich. Bei neuen Karrieren spielen zudem die beruflichen Tätigkeiten ausserhalb des Unternehmens eine zentrale Rolle – zum Beispiel die Familie, eine Weiterbildung oder der Aufbau einer Selbstständigkeit. Alternative Karrieren werden sich nur dann durchsetzen, wenn sie in Bezug auf Ansehen und Lohn gleich wie traditionelle Karrieren wahrgenommen werden.
Neue Anreize und Befreiung von Angst
Ein zweiter Schlüssel zur Veränderung der Kultur liegt im Design des Anreizsystems. Belohnt das Unternehmen Präsenz und traditionelle Karrieren mit höheren Löhnen, werden sich die Mitarbeitenden entsprechend verhalten. In einer geldgesteuerten Kultur befiehlt das Geld, wie sich die Mitarbeitenden verhalten. Um davon wegzukommen und die Mitarbeitenden anders als nur mittels Geld zu motivieren, braucht es eine offensichtliche Abkehr von Geld bei einer gleichzeitigen Aufwertung alternativer Währungen wie Zeit oder Aufmerksamkeit. Die Relativierung des Gelds wird durch das Abschaffen variabler Lohnanteile, den Bezug von Zeit statt Geld, die Transparenz der Löhne oder die Reduktion der Lohnspanne zwischen höchstem und niedrigstem Lohn unterstützt. Mittels Kultur-Initiativen sollen ausserdem Kreisläufe der Angst durchbrochen werden. Viele Probleme heutiger Unternehmen, wie endlose Abstimmungsprozesse, Silo-Denken oder das Zentralisieren von Entscheidungskompetenz, folgen aus Verhaltensweisen “ängstlicher Egos”. Folglich sollen Kulturinitativen das Selbstvertrauen der Mitarbeitenden stärken. Nicht überraschend, aber überraschend deutlich, zeigt eine aktuelle Google-Studie, dass das Selbstvertrauen der Individuen der wichtigste Erfolgsfaktor von Teams ist.
Freiwillige Identifikation
Die hypervernetzte Zukunft der Arbeit zeichnet sich durch eine starke Entgrenzung aus. Die Organisation verliert ihre klare Grenzen sowohl nach aussen als auch in ihrem Innern. Der Arbeitsvertrag wird zum Projektvertrag, Unternehmensgrenzen, Arbeitszeit und -ort werden relativ. Es ist unklar, wo Arbeit beginnt und wo sie aufhört. Das gilt je länger je mehr für alle Mitarbeitenden, weil der Einsatz der Maschinen die meiste Arbeit zeitlich und örtlich befreit. Entgrenzung setzt die Fähigkeit voraus, Grenzen zu setzen, um nicht von der Unendlichkeit und Unsichtbarkeit der Wissensarbeit überfordert zu werden. Eine starke Identität wirkt dieser Entgrenzung entgegen. Sie verbleibt in einem Kontext der Selbstbestimmung als einziges Instrument, um Stabilität und Orientierung herzustellen. Die gewünschte Identifikation kann bei der Zusammenarbeit von selbstständigen und autonomen Wissensarbeiterinnen nur freiwillig passieren.
Feel Good Manager
Die Unternehmensidentität wird dann von den Beteiligten gemeinsam hervorgebracht. Die wichtigste Aufgabe im Identitätsmanagement besteht darin, diese Aushandlungsprozesse in Gang zu bringen und deren Ergebnisse analog und digital sichtbar zu machen. Es geht um Möbel, um Architektur, aber auch um die Cafeteria, die Lobby, Kleider, Dinge, die den Mitarbeitenden gratis zur Verfügung gestellt werden (Getränke, Bücher, Abos) oder die Schnittstellen, wo (auch potenzielle und ehemalige) Mitarbeitenden mit dem Unternehmen bzw. dem HR in Kontakt kommen. Die gesteigerte Bedeutung von Mindset, Identität und Kultur schafft neue Berufsbilder. Die Identitätsmanager der Zukunft müssen offensichtlich nicht nur etwas von Kommunikation, sondern auch etwas von HR und Innenarchitektur verstehen. Feel Good Manager sorgen für eine gute Stimmung im Betrieb, sie unterhalten, belohnen und inspirieren. Es geht nicht um eine Wohlfühl-Kultur, in der keine Konflikte und kein Wettbewerb möglich sind, sondern um Gemeinschaft und Identifikation. Durch zufriedene Mitarbeitende sollen auch die Kunden zufriedener werden.
Kulturprogramm auch für Unternehmen
Um die Unternehmenskultur zu entwickeln und sichtbar zu machen, braucht es deren Kultivierung. Wie jedes Quartier und jede Stadt kulturelle Aktivitäten pflegt, um den Austausch, die Reflexion und die Unterhaltung der Bürgerinnen beziehungsweise der Gemeinschaft zu fördern, ist ein Kulturprogramm auch für Unternehmen sinnvoll. Das gilt umso mehr, je mehr Wissensarbeit ausserhalb der Unternehmens erfolgt und es gute Gründe braucht, damit Wissensnomaden tatsächlich vor Ort erscheinen. Menschen verkümmern, wenn sie nicht als soziale Wesen wahrgenommen werden und keine Gelegenheit finden, um sich als Menschen (ohne Rollen und Etiketten) zu begegnen. Kultiviert wirken Rituale, Anlässe, Vorträge, Zeitschriften und Apps, in denen das Unternehmen, sein Kontext und seine Zukunft thematisiert werden. Ein Arbeitgeber verstärkt so nicht nur den sozialen Zusammenhalt, er hat auch die Möglichkeit, Impulse zu setzen, die sich auf den Mindset auswirken. Routine gilt es zu verhindern, Inspiration setzt Überraschung und Irritation voraus. Inspiration bieten auch neue technische Hilfsmittel wie die Lunch Lottery, mit der zufällige Gruppen für die Mittagspause zusammengestellt werden.
Kultur als Hindernis
So wie die Kultur die wichtigste Kraft für die Veränderung der Arbeitswelt ist, stellt sie auch das grösste Hindernis im Wandel dar. Eine veränderungsscheue und von Angst geprägte Kultur macht es Mitarbeitenden schwer, aus ihren durch Hierarchien, Zielen und Regeln geprägten Käfigen auszubrechen. Sie werden sich scheuen, Kritik zu äussern und mit Routinen zu brechen. Doch gerade solcher “Ungehorsam” ist nötig, wenn radikal neue Ideen entstehen und sich diese rasch verbreiten sollen. Für die alte Welt kämpfen insbesondere jene, die durch den Wandel glauben, etwas zu verlieren. Es sind die mittleren und Top Manager, die ihren Einfluss und ihren Status in Gefahr sehen und sich nicht mit einer flüchtigeren, flexibleren, schnelleren und demokratischeren Zukunft abfinden wollen. Sie machen ihren Einfluss geltend, um sich vor den Veränderungen zu schützen und weil sie glauben, dass Stabilität ein Mittel gegen Veränderung ist. Häufig sind sie im Kern wenig selbstbewusst und noch wenig mit dem digitalen Mindset infiziert.